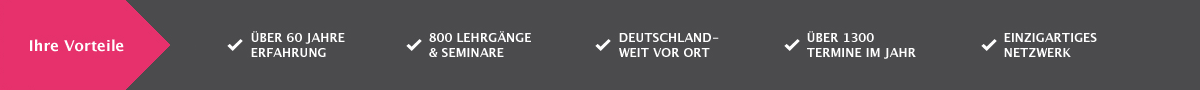FQS-Forschungsprojekt QualiJet: Qualitätssicherung im 3D-Druck – automatische Entpulverung von Grünteilen bei zweistufigen additiven Fertigungsverfahren

In der additiven Fertigung bieten sinterbasierte Verfahren, wie das Metal Binder Jetting (MBJ), eine vielversprechende Möglichkeit, kostengünstig Einzelteile und Kleinserien zu produzieren. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eröffnen sich hier neue Perspektiven, da diese Verfahren eine hohe Gestaltungsfreiheit, Flexibilität und die Möglichkeit zur effizienten Produktion komplexer Bauteile bieten. Die im Rahmen dieser Fertigungsverfahren erforderliche Entpulverung der Grünteile stellt für Unternehmen eine zentrale Herausforderung dar, da hierfür meist ein manuell aufwendiger Prozess erforderlich ist und die zerbrechlichen Grünteile leicht beschädigt werden können.
Im Rahmen des über die FQS – Forschungsgemeinschaft Qualität geförderten Forschungsprojekts „QualiJet“ wird in einem Zeitraum von zwei Jahren ein automatischer Prozess entwickelt, der Grünteile aus zweistufigen additiven Fertigungsverfahren mithilfe eines lernfähigen Greifers aus dem Pulverbett entfernt. Durchführende Forschungseinrichtungen sind das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM (Bremen) und das IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH. Rund 15 Unternehmen begleiten die Forschungsarbeiten als Industriepartner im Projektbegleitenden Ausschuss.
Im Interview geben Lea Reineke (Fraunhofer IFAM) und Nils Doede (IPH gGmbH) einen Ausblick auf das Projekt. Sie erläutern, wie Unternehmen von den Forschungsergebnissen profitieren können.
Aus welcher Problemstellung heraus ist das Forschungsprojekt entstanden?
Reineke: Das MBJ und andere zweistufige Verfahren erzeugen im ersten Schritt Grünteile, die im Anschluss getrocknet, entpulvert und gesintert werden müssen. Das Drucken und Sintern sind weitgehend automatisierte Prozesse, in denen nur die Rüstzeit ein relevanter manueller Prozess ist. Insbesondere für das Sintern gibt es viele Dienstleister, die ihre Öfen sehr effizient betreiben. Verglichen damit ist das Entpulvern der Bauteile ein kritischer Punkt in der Prozesskette, da die teils geometrisch komplexen Grünteile aus dem Pulverbett entfernt werden müssen und gleichzeitig geringe Festigkeiten aufweisen. Die Entpulverung ist daher bis heute ein aufwendiger, manueller und langwieriger Prozess, in dem die Grünteile von den Bearbeitern leicht beschädigt werden können. Besonders bei kleinen Grünteilen, die in hoher Anzahl im Bauraum verteilt sind, kann das Entpulvern einen der größten Anteile an Zeit und Kosten in der Prozesskette in Anspruch nehmen.
Die hohen Personalkosten stellen insbesondere für KMU eine große Herausforderung dar. Zudem können die monotonen Arbeitsschritte zu Unachtsamkeit und damit zu Beschädigungen und Ausschuss führen. Außerdem müssen die Mitarbeitenden wissen, wo die verschiedenen Grünteile im Bauraum liegen, damit sie diese nicht aus Versehen mit dem Pulver in die Siebanlage transportieren. Im Gegensatz zu allen anderen Prozessschritten lässt sich die Ausschussrate nicht durch eine Parameteroptimierung einstellen, sondern ist bisher einzig abhängig von der Fähigkeit und Ausdauer des Personals.
Welches Know-how wird im Rahmen des Forschungsprojekts QualiJet entwickelt und wie kann es zur Lösung der geschilderten Problemstellung beitragen?
Doede: Zur Verbesserung der Entpulverung ist das Ziel des Projekts QualiJet die Entwicklung eines neuartigen, automatischen Prozesses, welcher die Grünteile aus zweistufigen additiven Fertigungsverfahren intelligent aus dem Pulverbett entfernen soll. Dies soll am Metal Binder Jetting-Prozess demonstriert werden. Hierbei liegt die besondere wissenschaftliche Herausforderung in dem automatisierten Greifen der individuellen und leicht zerbrechlichen Grünteile. Das System soll durch einen Roboter-Greifer unterstützt werden, welcher mittels Künstlicher Intelligenz (KI) flexibel auf die individuellen Eigenschaften der Grünteile reagieren kann. Bei diesem neuartigen Ansatz erkennt das Greifsystem, wo und wie die Grünteile im Pulverbett liegen, welches die geeigneten Greifpunkte sind. Es lernt das Greifen von Grünteilen mit unterschiedlichen lokalen Festigkeiten. Das Greifsystem soll in der Lage sein, verschiedene Grünteile freizulegen, zu entnehmen und an einem sicheren Ort abzulegen.
Wer soll von den Ergebnissen profitieren und welcher konkrete Nutzen ergibt sich für Unternehmen?
Reineke: Obwohl die additive Fertigung KMU vielseitige neue Chancen bietet, wird die Technologie bisher selten genutzt. Ein Grund sind fehlende finanzielle und personelle Ressourcen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts QualiJet sollen kurzfristig nach Projektabschluss für KMU nutzbar sein. Die innovativen Ergebnisse des Forschungsprojekts können die benötigten Mitarbeiterressourcen in zweistufigen additiven Fertigungsverfahren reduzieren und KMU den Einstieg in die Technologien erleichtern.
Doede: Die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine bessere Ausbringungsmenge und geringere Kosten erweitert den potenziellen Nutzerkreis und leistet einen Beitrag zur Entstehung von neuen und Erweiterung bestehender Geschäftsfelder. So könnten Bauteile in Serienfertigung bis circa 100.000 Teile pro Jahr durch MBJ produziert werden, die aufgrund der geringen Produktivität nicht per selektivem Laserstrahlschmelzen hergestellt werden. Auch Marktsegmente, die aktuell suboptimal durch Spritzgießen oder Pressen belegt sind, können durch MBJ ergänzt werden, da die Prozesskette und die Materialeigenschaften sehr ähnlich sind. Somit wirkt es sich positiv auf das Wachstum der zweistufigen additiven Fertigungsverfahren aus. Unter anderem können so massenindividuelle Produkte, wie beispielsweise patientenindividuelle Medizinprodukte, günstiger produziert werden.
Aufgrund der Vermeidung von Unachtsamkeiten der Mitarbeitenden reduziert die Automatisierung der Entpulverung von Grünteilen die Ausschussrate und erhöht somit die Reproduzierbarkeit der Produktqualität. Somit wird die Nachhaltigkeit durch einen ressourcenschonenderen Prozess erhöht.
Wie sieht das weitere Vorgehen im Forschungsprojekt aus?
Reineke: Die nächsten Schritte des Projekts belaufen sich auf die Finalisierung der Szenarienanalyse: In welchen Fällen soll der Greifer eingesetzt werden, was sind dessen Grenzen und wie können diese noch weiter verschoben werden? Darüber hinaus wird die Umgebung des Greifers entwickelt. Es benötigt einen Bereich für den Bauraum, einen für das Ablegen der Bauteile, einen Ruhepunkt und eventuell sicherheitstechnische Umgebungen. Nicht zuletzt wird aktuell auch an den Materialien im Metal Binder Jetting gearbeitet.
Stimmen aus dem Projektbegleitenden Ausschuss:
André Heinke, Leiter Vertrieb und Marketing, Bitmotec GmbH
Die Bitmotec GmbH engagiert sich als Partner im Projektbegleitenden Ausschuss, weil wir davon überzeugt sind, dass eine datenbasierte Qualitätssicherung der Schlüssel zur Effizienzsteigerung in der additiven Fertigung ist.
Mit unserem BITMOTECOsystem, einer industriellen Datenplattform, vernetzen wir Maschinen und Sensoren, um Prozess- und Qualitätsdaten strukturiert zu erfassen, zu analysieren und in wertvolle Informationen für die Produktion zu übersetzen. Gerade bei zweistufigen additiven Fertigungsverfahren ist eine durchgängige Erfassung und Auswertung von Prozessdaten essentiell, um Qualitätsabweichungen frühzeitig zu erkennen und Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
Durch unsere Teilnahme am Forschungsprojekt erwarten wir wertvolle Erkenntnisse darüber, wie digitale Datenströme optimal für eine verbesserte Prozessüberwachung und Qualitätssicherung genutzt werden können. Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern hilft uns, unser BITMOTECOsystem weiterzuentwickeln, um datenbasierte Lösungen für eine noch präzisere und effizientere additive Fertigung zu ermöglichen.
Tim Marter, Process Engineer, Element22 GmbH
Die Element22 GmbH betreibt erfolgreich einen Cold-Metal-Fusion-Drucker (CMF-Drucker), ein pulverbettbasiertes System zur Herstellung hochwertiger Titanbauteile. Eine der zentralen Herausforderungen in diesem Prozess besteht in der effizienten und beschädigungsfreien Entpulverung der Grünteile, die derzeit manuell erfolgt.
Durch die Teilnahme am Forschungsprojekt QualiJet erhofft sich Element22 eine innovative Lösung zur Automatisierung dieses Prozessschrittes, mit dem Ziel, sowohl die Produktionskosten zu senken als auch die Ausschussquote zu minimieren. Ein erfolgreicher Ansatz würde somit einen unmittelbaren industriellen Anwendungsfall darstellen.
Aspekte, die aus Sicht von Element22 dabei von besonderer Bedeutung sind, umfassen die Zuverlässigkeit der Anlage hinsichtlich des Teile-Handlings und der langfristigen Betriebsfähigkeit in einer staubbelasteten Umgebung, Explosionsschutzmöglichkeiten im Kontext von verwendeten Materialien und Prozessbedingungen, die Notwendigkeit manueller Nachbearbeitung durch Fachkräfte, die Prozessgeschwindigkeit sowie die Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse auf andere Materialien wie Titan.
Über die Interviewpartner:
Lea Reineke, Projektleiterin Additive Fertigung am Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM
Nils Doede, Projektingenieur am IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH
Über das Forschungsprojekt: Weitere Informationen zum Projekt und zu Beteiligungsmöglichkeiten können über die Geschäftsstelle der FQS bezogen werden. Eine Mitarbeit im Projekt ist auch nach Laufzeitbeginn noch möglich. Über die FQS: Vorstellung der FQS Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. Kontakt:
Informationen zum Forschungsprojekt und Kontaktdaten
Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. (Förderkennzeichen: 01IF23272N; Forschungsvereinigung: FQS – Forschungsgemeinschaft Qualität e.V.)
Die FQS – Forschungsgemeinschaft Qualität e. V. (FQS) unterstützt seit 1989 die anwendungsorientierte Forschung rund um das Thema Qualität in Deutschland. Sie versteht sich selbst als Forschungsbereich der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) und wird von ihr getragen. Die FQS fördert innovative Forschungsideen über das Instrument der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und des Forschungsnetzwerks CORNET des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). Ziele der Förderung sind möglichst anwendungsnahe Forschungsideen, die einen unmittelbaren Nutzen für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), erbringen.
Wer ist die FQS Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. und was tut sie? Lernen Sie im Video den Forschungsbereich der DGQ kennen und erfahren Sie von Dr. Christian Kellermann-Langhagen, wissenschaftlicher Geschäftsführer der FQS, wie die FQS arbeitet, welche Themen beforscht werden und wie sich Unternehmen in der FQS beteiligen und von den eingesetzten Förderprogrammen profitieren können.
FQS – Forschungsgemeinschaft Qualität e. V.
August-Schanz-Straße 21A
60433 Frankfurt am Main
infofqs@dgq.de